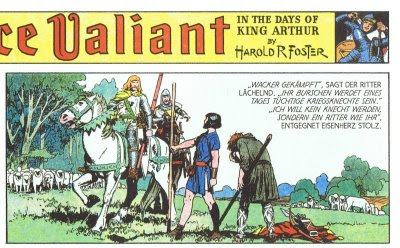Linux, der Retter, war da!Harmlos hat es angefangen. Mein Nachbar lud mich unter der Woche zum Mittagessen im Kreise der Kleinfamilie ein. Ich möge nur ein viertel Stündchen vorher kommen, seinen Laptop wieder in seinem W-Lan anmelden. Er habe ihm nach Ärger mit einem Stück Software, das nicht richtig lief, ein frisches Windows XP aufgezogen. Nun müsse noch die übliche Netzverbindung eingerichtet werden.
Es stellte sich heraus, dass der gute (und glänzende) Tchibo-Laptop seine eigene eingebaute W-Lan-Hardware nicht mehr erkannte. Mit der aufgedruckten Tastenkombination ließ sich der Funk aus- und einschalten, im Bios war er sichtbar, nur Windows wusste nichts davon.
Net Stumbler, den ich versuchweise installierte, bewies klar: Keine eigene Funkeinrichtung vorhanden.
Der Nachbar hat dann
hier über Medion Treiber zum Herunterladen gefunden und installiert. Kaum waren sie drin, war auch er wieder »drin«. Alles in Butter?
Es zeigte sich, dass auf dem Rechner nun
zwei Windows XP saßen, eines auf C, ein neues auf D. Das gute alte lief auf C, war völlig in Ordnung und hatte alle seine gewohnten Programme, Einstellungen, Mails und so weiter nach wie vor dabei. Also starteten wir das System dort.
Das neue Windows auf D war überflüssig. Wir wollten es löschen. Ich wusste aber nicht wie, weiß das immer noch nicht. Also meinte der Nachbar, lass uns D frisch formatieren, dann ist es weg. Richtig, nach einigen Sicherheitsbremsungen gelang es uns, D sauberzuputzen. Ein großes Gefühl, so ein
Format D:. Nur
Format C: ist higher.
Beim Starten ließ und der Rechner nach wie vor die Wahl, das eine oder das andere (nicht mehr vorhandene) Windows zu starten. Blödsinn. Also habe ich ein bisschen mit der
boot.ini gespielt, so lange (ein Uhr null sieben nachts) bis der kleine Rechner nur mehr direkt von der nicht vorhandenen Windows-Installation auf D starten wollte, also garnicht. Das passiert, wenn unter der Zeile »[operating systems]« nur mehr eines steht, bei uns leider nächtens das falsche. Vorsichtshalber hatte ich keinen Wiederherstellungspunkt gemacht (Start, Ausführen, msconfig, Allgemein, Systemwiederherstellung starten, Einen Wiederherstellungspunkt erstellen), sodass auch damit keine reumütige Rückkehr möglich war. Im
Recovery-Modus von der Windows-Original-CD gab es keinen Editor, womit der verhundsten
boot.ini beizukommen gewesen wäre, und
bootcfg kannte ich noch nicht. Also: Ende der Fahnenstange.

Der Nachbar zog prompt ein altes
Knoppix-Linux vom April 2003 auf einer c’t-Diskette aus dem Regal (Version 3.1, im Bild ein etwas neueres). Damit ließ sich wunderbar auf seine Platte beziehungsweise deren mehrere Partitionen gucken. Mir war Linux neu. Das nur mit der internen Maus steuerbare System reagiert ungewollt schnell schon auf bloßes Verweilen über einem »Knopf«. (Der Name
Knoppix stammt aber nicht daher:
Der Mann heißt so und ist Diplomingenieur.) Wir sind dann ein bisschen in der Linux-Welt herumgeirrt, haben die boot.ini gefunden und sogar wieder zurückkorrigiert, ganz zwecklos, denn sie ließ sich nicht zurückspeichern, mangels Rechten, wie Knoppix anmahnte. Außerdem zeigte sich später, dass dieses Knoppix vorsichtshalber nicht auf NTFS-formatierte Partitionen schreibt.
Eineinhalb Tage später war alles noch viel schlimmer. Ich hatte inzwischen zwar herausgefunden, dass sich mit
bootcfg /rebuild im Windows-Reparaturmodus die
boot.ini neu schreiben lässt, doch: zu spät. Microsoft hatte C ganz verloren. Schon
dir C: streikte. Nichts da. Leere. Meinem Nachbarn war es nämlich inzwischen ganz alleine gelungen, irgendwelche wichtige Sektoren auf der Platte zu himmeln. Selbst
chkdsk weigerte sich, C überhaupt zu untersuchen; das Dateisystem sei gestört.
Nun kann man einen kaputten
MBR (Master Boot Record) mit
fixmbr wieder neu schreiben. Für uns kam allerdings im letzten Augenblick die Warnung, dass man sich damit vielleicht endgültig alle Daten unzugänglich machen könnte. Vermutlich hätten wir mit einem »erfolgreichen« Lauf von
chkdsk ähnliche innere Blutungen ausgelöst. Frage: Ob vielleicht Linux die Platte noch lesen konnte? Die Chance stand bei fünf Prozent.

Linux konnte. Alles war da. Die Dateien auf C standen da, also hätte sie nie ein Lüftchen angehaucht. Wir begrüßten unsere alte, eigenhändig verunstaltete
boot.ini. Also hieß es, mit Linux den Master Boot Record neu schreiben. Wie das ging, dafür darf ich im Schnelldurchgang mein von
Carla Schroder auf einer IBM-Internetseite ad-hoc gelerntes Wissen weitergeben.
Carla Schroder hat 2004 die erste Ausgabe eines
Linux Cookbooks geschrieben, deutsch 2005 als
Linux Kochbuch erschienen (natürlich immer mit fehlendem Bindestrich …).
Um zeilenweise Befehle in Linux einzugeben – genau das schreibt sie leider nicht – braucht man eine »Konsole«; der Knopf dazu war unten etwa in der Mitte der Knopfleiste. Im schwarzen Kasten – das scheint bei Linux und Windows gleichermaßen auf Altes hinzudeuten, obwohl wir damals Weiß auf Blau bevorzugt hatten – erscheinen eher abschreckende Prompts wie
knoppix@ttyp0[knoppix]#. Vorne steht der jeweilige Benutzername. Benutzer
knoppix darf erst einmal gar nichts, schon gar nicht auf der Platte herumschreiben. Man muss auf den wohlprivilegierten Nutzer
root (wörtlich
Wurzel, hier wohl
Wurzelsepp) umsteigen
, und das ging (laut
Heise-Anleitung) mit
sudo su - (
switch user auf
superuser). Als
root angemeldet konnte ich das Linux-Programm
Testdisk von Christophe Grenier starten. Und was ganz Microsoft nicht geschafft hatte, dieser Franzose konnte es: Die Partition C der Festplatte meines Nachbarn immer noch lesen. Doch ach, auch dieses Testdisk meldete
bad relative sector. Es war ja wirklich was gestört auf der Partition. Also reparieren.
Beim dritten von Testdisk angezeigten Zwischenergebnis gab es die Möglichkeit zu schreiben. Das habe ich dann mutig getan …
… und hatte fortan eine selbst für Microsoft wieder wohlgenießbare Platte mit den Partitionen C und D, Licht am Ende des Tunnells. Frisch die Betriebssystem-Original-CD eingelegt, neu gestartet, schnell noch (vor dem Laden des unladbaren, da inexistenten Windows’ von der Platte) auf die Taste gedrückt und somit von CD geladen, den Reparaturmodus gewählt –
hier Details, also R eingeben, dann 1, dann leer lassen (da kein Administratorkennwort gesetzt war), und gleich einmal
bootcfg /scan laufen lassen. Wunderbar, unser altes, einziges Windows wurde auf C gefunden. Der Befehl
bootcfg /rebuild hat es dann wieder hoffähig (startfähig) gemacht. Ich musste ihn noch einen Namen geben, nannte es
wiedergefunden, und durfte dann die üblichen Startparameter eintragen:
/fastdetect /NoExecute=OptIn. Die Parameter lassen sich auch später mit einem Editor nachtragen. Anschließend bootete das System wieder von der Festplatte, ließ man ihm Zeit sogar von der richtigen Windows-Installation. Es brachte allerdings immer noch die unsinnige Auswahl zwischen dem guten und dem gelöschten Windows. Ich habe in
boot.ini dann (diesmal) die (richtige) Zeile mit dem gelöschten Betriebssystem entfernt. Seitdem startet der Laptop wie jeder gute Rechner direkt und durch.
PS. Der eventuell neuerdings vorhandene Parameter
/usepmtimer besagt nicht, dass man nachmittags besser auf die Uhr sehen soll, als wir es getan haben, er stellt bei manchen Doppelprozessorrechnern sicher, dass die Uhren beider Rechner synchron laufen. PM steht für Prozessmanager.
Fastdetect hat etwas mit neuerer automatischer Erkennung an Com-Ports zu tun, und hier dann noch die Erklärung von
NoExecute, dem
eingeschränkten Datenausführungsschutz. Alles zu
boot.ini finden Sie hier.
 scheints je weiter südlich und östlich, desto weniger teuer. Also gibt es Umpacker, die die, sagen wir, französischen oder ungarischen Schachteln aufmachen, die dortigen Beipackzettel wegwerfen, und den Inhalt dann eingedeutscht hier in den Handel bringen, ganz offiziell. Das Medikamentenparallelhandelsvolumen hat Frost & Sullivan 2005 auf rund drei Milliarden Euro geschätzt. Das Hauptproblem dabei scheinen weniger Arbeits-, Transport oder Handelsaufwand zu sein, eher Warenzeichen- und Urheberrechtsfragen bei den Drucksachen. Dagegen gibt es Fachbücher: Rechtsanwalt Dr. Stefan Lieck hat 2007 seine Doktorarbeit darüber gemacht, »unter arzneimittel-, marken- und patentrechtlichen Aspekten«. Das Umpacken birgt freilich auch die Gefahr gefälschten Inhalts, das aber wird sich regeln lassen. »Parallelhändler begehren gegen die Pläne von EU-Kommissar Günter Verheugen auf, ein EU-weites Umpackverbot von Arzneimitteln durchzusetzen. Sie fürchten den Verlust von mehreren Tausend Arbeitsplätzen, Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und eine Zunahme des illegalen Medikamentenhandels«, lobbyt das deutsche Ärzteblatt.
scheints je weiter südlich und östlich, desto weniger teuer. Also gibt es Umpacker, die die, sagen wir, französischen oder ungarischen Schachteln aufmachen, die dortigen Beipackzettel wegwerfen, und den Inhalt dann eingedeutscht hier in den Handel bringen, ganz offiziell. Das Medikamentenparallelhandelsvolumen hat Frost & Sullivan 2005 auf rund drei Milliarden Euro geschätzt. Das Hauptproblem dabei scheinen weniger Arbeits-, Transport oder Handelsaufwand zu sein, eher Warenzeichen- und Urheberrechtsfragen bei den Drucksachen. Dagegen gibt es Fachbücher: Rechtsanwalt Dr. Stefan Lieck hat 2007 seine Doktorarbeit darüber gemacht, »unter arzneimittel-, marken- und patentrechtlichen Aspekten«. Das Umpacken birgt freilich auch die Gefahr gefälschten Inhalts, das aber wird sich regeln lassen. »Parallelhändler begehren gegen die Pläne von EU-Kommissar Günter Verheugen auf, ein EU-weites Umpackverbot von Arzneimitteln durchzusetzen. Sie fürchten den Verlust von mehreren Tausend Arbeitsplätzen, Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und eine Zunahme des illegalen Medikamentenhandels«, lobbyt das deutsche Ärzteblatt.